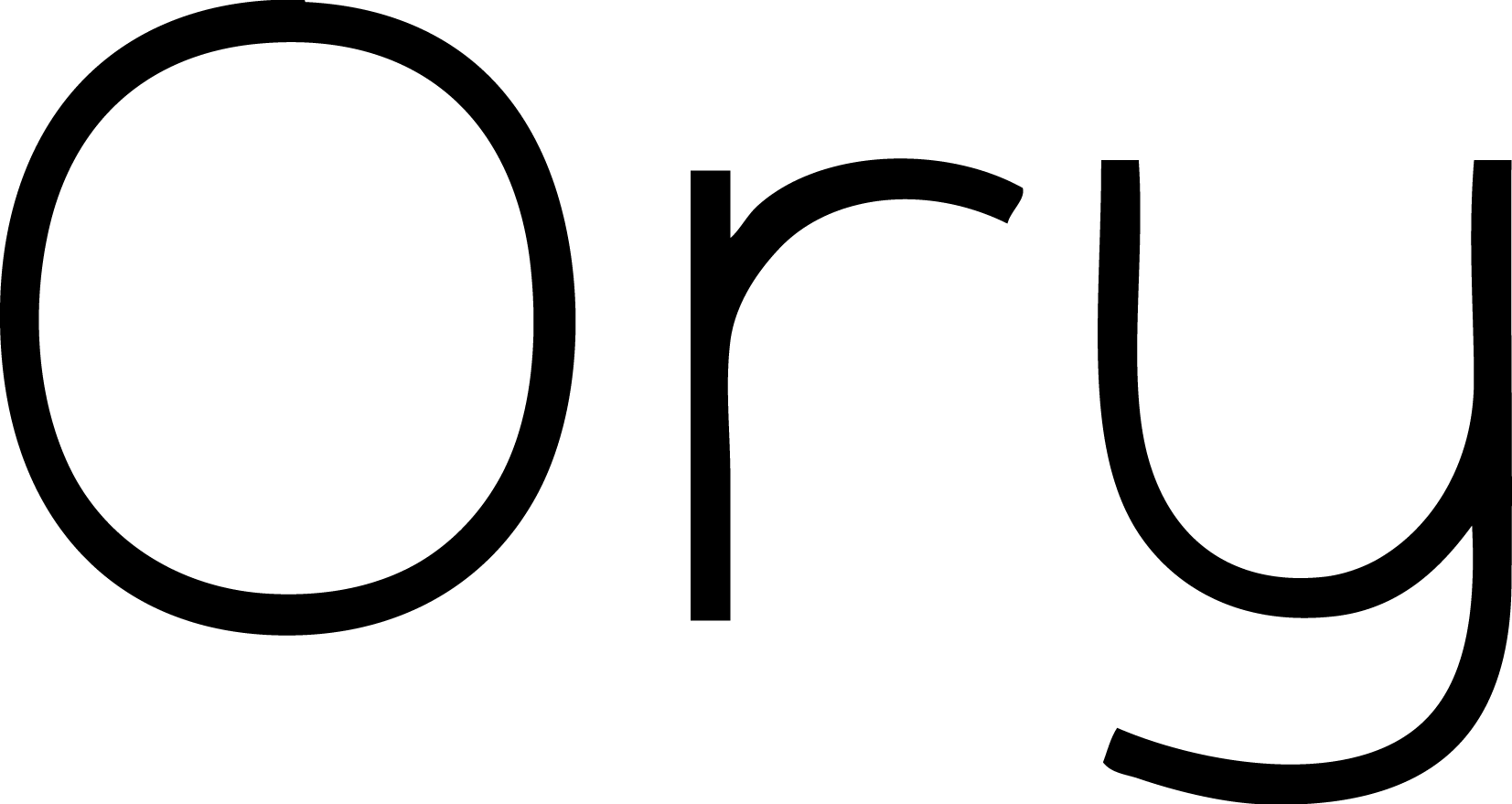Laborwerte
Ganzheitliche Laboranalysen verstehen - Was Ihre Befunde verraten.
Laborwerte sind der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis Ihrer Gesundheit. Eine ganzheitliche Laboranalyse betrachtet den Körper nicht isoliert, sondern als vernetztes System aus Stoffwechsel, Hormonen, Nährstoffen und Immunabwehr. So lassen sich Ungleichgewichte frühzeitig erkennen – noch bevor Beschwerden entstehen.
Wer seine Laborwerte versteht, kann aktiv an seiner Gesundheit mitwirken. Ganzheitliche Analysen schaffen Klarheit und geben Orientierung für eine nachhaltige Balance von Körper, Geist und Stoffwechsel.
Vollblutmineralanalyse (Kapillar):
Sie misst Mineralstoffe und Spurenelemente direkt in den Zellen und im Plasma, also im gesamten Blut – nicht nur im Serum. Dadurch spiegelt sie den tatsächlichen Zellstatus und Stoffwechselzustand besser wider. Besonders bei Magnesium, Zink, Selen oder Eisen liefert sie aussagekräftigere Werte über die Versorgung im Gewebe. Außerdem reicht eine kapillare Fingerbeerenprobe, was die Methode schnell, schonend und praxistauglich macht.
Selen
Selen im Vollblut.
Bedeutung:
Selen ist einessenzielles Spurenelement, das der Körper nicht selbst herstellen kann und daher über die Nahrung aufnehmen muss.
Es spielt eine zentrale Rolle als Bestandteil verschiedenerSelenoproteine, darunter insbesondere dieGlutathionperoxidase (GPx)– ein wichtiges antioxidatives Enzym, das Zellschäden durch freie Radikale verhindert.
Darüber hinaus ist Selen wichtig für:
- Schilddrüsenfunktion: Bestandteil der Dejodasen, die T4 (Thyroxin) in das aktive T3 (Trijodthyronin) umwandeln.
- Immunsystem: Unterstützt die Aktivität von T-Zellen und schützt Immunzellen vor oxidativem Stress.
- Entzündungshemmung und mögliche Krebsschutzwirkung (in physiologischen Mengen).
- Entgiftung Glutathionperoxidase (GPx)
Interpretation:
Referenz: 100–140 µg/l. Optimalbereich (präventivmedizinisch): 140–160 µg/l (maximale Enzymaktivität).
Selen im Vollblut – Bedeutung und Interpretation
Mögliche Ursachen für erniedrigtes Selen
- Geringe Zufuhr über Ernährung: Mitteleuropäische Böden sind selenarm, daher enthalten Getreide und pflanzliche Lebensmittel oft wenig Selen.
- Vegetarische oder vegane Ernährung:Tierische Produkte (v. a. Fisch, Fleisch, Eier) sind die Hauptquellen.
- Erhöhter Verbrauch:Bei Entzündungen, Infektionen, oxidativem Stress oder chronischen Erkrankungen.
- Malabsorption:Etwa bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Zöliakie oder nach Magen-Darm-Operationen.
Ergänzende Diagnostik
- Glutathionperoxidase (GPx):Aktivitätsmessung erlaubt Rückschluss auf funktionellen Selenstatus Entgiftungskapazität.
- Schilddrüsenparameter: TSH, fT3, fT4 – zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion.
- Selenverlauf im Vollblut:Kontrollmessung nach 3–6 Monaten bei Substitution oder geänderter Ernährung.
- CRP / Entzündungsmarker: Zur Beurteilung, ob niedrige Werte durch akute oder chronische Entzündung bedingt sein könnten.
Zink
- Bezeichnung: Zink im Vollblut.
- Bedeutung: Cofaktor zahlreicher Enzyme, wichtig für Immunsystem, Haut, Hormon- und Zellfunktion.
Interpretation:
- (Referenz: 7,0–7,6 mg/l) → im Optimalbereich.
Ergänzende Diagnostik: Bei Entzündungen CRP mitbewerten, da Zink bei Akutphasenreaktionen sinken kann.
Kupfer
Bezeichnung: Kupfer im Vollblut.
Bedeutung: Bestandteil von Enzymen der Eisenverwertung, antioxidativen Abwehr und Kollagensynthese.
Interpretation:
Ihr Wert: 1,01 mg/l (Referenz: 0,85–1,05 mg/l) → normal.
Ergänzende Diagnostik: Ceruloplasmin bei Verdacht auf Speicherkrankheiten oder Entzündungen.
Magnesium
Bezeichnung: Magnesium im Vollblut.
Bedeutung: Cofaktor vieler Enzyme, wichtig für Muskeln, Nerven, Energieproduktion.
Interpretation:
Ihr Wert: 36,1 mg/l (Referenz: 35,0–39,0 mg/l) → optimal.
Ergänzende Diagnostik: Keine routinemäßig nötig.
Calcium
Bezeichnung: Calcium im Vollblut.
Bedeutung: Knochenstoff, an Muskelkontraktion, Blutgerinnung und Zellstoffwechsel beteiligt.
Interpretation:
Ihr Wert: 65,6 mg/l (Referenz: 57,0–61,0 mg/l) → erhöht.
Mögliche Ursachen: Vitamin-D-Supplementation, gesteigerte Knochenresorption, Hyperparathyreoidismus.
Ergänzende Diagnostik: Serum-Calcium (ionisiert), Parathormon, 25(OH)-Vitamin D, Nierenfunktion.
Kalium
Bezeichnung: Kalium im Vollblut.
Bedeutung: Wichtig für Muskelkontraktion, Herzrhythmus und Zellfunktion.
Interpretation:
Ihr Wert: 1792 mg/l (Referenz: 1750–1900 mg/l) → im Normbereich.
Ergänzende Diagnostik: Nur bei klinischem Verdacht (z. B. Herzrhythmusstörungen).
Prevent 360 – Ganzheitlicher Gesundheits- und Stoffwechselcheck
Der Prevent 360 Test ist eine umfassende Labordiagnostik, die den Stoffwechsel, die Mikronährstoffversorgung, die Energieproduktion, die Entgiftungsleistung, das Darmmikrobiom und den Fettsäurehaushalt ganzheitlich analysiert.
Er basiert auf einer Kapillarblutprobe (MITRA) und deckt über 60 Laborparameter ab – von Vitaminen und Mineralien über Aminosäuren bis zu Gallensäuren und Stresshormonen.
Vitamin D3 (25-OH-Vitamin D)
Bezeichnung der Labordiagnostik: 25-Hydroxy-Vitamin D3 (Calcidiol).
Bedeutung / Beschreibung: Fettlösliches Vitamin, wichtig für Knochenstoffwechsel, Immunsystem, Muskelfunktion und Stimmung.
Interpretation:
Ihr Wert: 15 ng/ml (< 30 ng/ml) → Vitamin-D-Insuffizienz / Mangel.
Mögliche Folgen: verminderte Immunabwehr, Muskelschwäche, Stimmungstiefs, Osteopenie-Risiko.
Ergänzende Diagnostik: 25(OH)D-Kontrolle nach 3 Monaten Therapie; ggf. Calcium, Magnesium, PTH; Kombination mit Vitamin K2 sinnvoll.
Magnesium
Bezeichnung: Magnesium im Kapillarblut.
Bedeutung: Cofaktor in > 300 Enzymreaktionen (Energieproduktion, Muskeln, Nerven, Herzrhythmus).
Interpretation: 36,8 mg/l (Referenz 34–39,5 mg/l) → untere Norm / tendenziell niedrig.
Ergänzende Diagnostik: Vollblut-Mg-Verlauf, ggf. Magnesium-/Kalium-Balance; bei Muskelkrämpfen i.v. oder orale Substitution prüfen.
Zink
Bezeichnung: Zink im Kapillarblut.
Bedeutung: Immunabwehr, Haut, Wundheilung, antioxidativer Schutz.
Interpretation: 7,25 mg/l (Norm 6,7–7,7) → optimal.
Ergänzende Diagnostik: Keine erforderlich.
Selen
Bezeichnung: Selen im Kapillarblut.
Bedeutung: Bestandteil der Glutathionperoxidase (antioxidativ, Schilddrüse, Immunität).
Interpretation: 50 µg/l (Referenz 96–130 µg/l) → deutlich erniedrigt.
Präventiv optimal wären ≥ 120 µg/l.
Ergänzende Diagnostik: GPx-Aktivität, Schilddrüsen-Parameter; Vollblut-Selen-Kontrolle nach 3 Monaten Supplementierung.
Eisen
Bezeichnung: Eisen im Kapillarblut.
Bedeutung: Bestandteil von Hämoglobin und Zellatmung.
Interpretation: 470 mg/l (Norm 440–540) → normal.
Ergänzende Diagnostik: Ferritin, Transferrinsättigung bei Anämie- oder Müdigkeitssymptomen.
ADMA / SDMA
Bezeichnung: Asymmetrisches / symmetrisches Dimethylarginin.
ADMA (asymmetrisches Dimethylarginin) und SDMA (symmetrisches Dimethylarginin) sind Abbauprodukte der Aminosäure Arginin.
- ADMA hemmt die Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) → kann Gefäße verengen und ist ein Risikomarker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- SDMA beeinflusst den Arginintransport und wird über die Niere ausgeschieden → ein Marker für Nierenfunktion.
Bedeutung: Marker der endothelialen NO-Produktion (gefäßregulierend).
Interpretation: ADMA 0,35 (< 0,66) → normal; SDMA 0,80 (> 0,35) → erhöht, Hinweis auf eingeschränkten NO-Stoffwechsel oder renale Belastung.
Ergänzende Diagnostik: Nierenfunktion, Arginin/Citrullin-Status.
Laktat
Bezeichnung: Laktat im Kapillarblut.
Bedeutung: Marker für anaerobe Energiegewinnung und Mitochondrienfunktion.
Interpretation: 6450 µmol/l (Norm 1490–5440) → erhöht.
Hinweis auf mögliche mitochondriale Funktionsstörung oder oxidativen Stress.
Ergänzende Diagnostik: BHI+ (Biovis Health Index), Laktat-/Pyruvat-Quotient, Coenzym Q10.
Arginin / Citrullin
Bezeichnung: Aminosäuren des Harnstoffzyklus.
Bedeutung: NO-Produktion, Ammoniakentgiftung, Durchblutung.
Interpretation: Arginin 2,0 (< 4,45) → erniedrigt; Citrullin 10,2 (normal) → Hinweis auf ungünstiges Verhältnis, NO-Mangel.
Ergänzende Diagnostik: L-Arginin-/Citrullin-Verhältnis, SDMA, NO-Marker.
Glutamin / Glycin / Asparagin-Gruppe
Bezeichnung: Glukogene Aminosäuren.
Bedeutung: Energie- und Glukosestoffwechsel, Immunsystem, Darmgesundheit.
Interpretation: Glutamin 50 (< 92) → stark erniedrigt; Glycin 302 → ok; Asparagin 50 → ok; → Hinweis auf Energiemangel oder Katabolismus.
Ergänzende Diagnostik: mitochondriale Parameter, Aminosäure-Profil Verlauf.
Tryptophan / Kynurenin
Bezeichnung: Serotonin-/IDO-Achse.
Bedeutung: Stimmung, Stress-Balance, Immun-/Entzündungsaktivität.
Interpretation: Tryptophan 31 (normal), Kynurenin 2,0 (> 1,2) → erhöht, IDO-Aktivität ↑ (2,0 Ratio > 49 Norm) → Hinweis auf chronischen Entzündungsreiz.
Ergänzende Diagnostik: hs-CRP, Cortisol, Vitamin B6 (Status bei Tryptophan-Metabolismus).
Omega-3-Fettsäuren (EPA/DHA)
Bezeichnung: Eicosapentaensäure + Docosahexaensäure.
Bedeutung: Entzündungsmodulation, Zellmembranen, Herz-/Gehirnfunktion.
Interpretation: EPA 1,62 % (< 2) und DHA 3,2 % (< 6) → deutlicher Mangel.
Omega-3-Index 0,51 (> 8**) → stark erniedrigt.
Ergänzende Diagnostik: Wiederkontrolle nach 3 Monaten Omega-3-Supplementierung; AA/EPA-Quotient (4,97 → gut < 8).
Gallensäurenmetabolismus
Bezeichnung: Primäre, sekundäre und tertiäre Gallensäuren.
Bedeutung: Fettresorption, Leber-Darm-Signalwege, Mikrobiomaktivität.
Interpretation: Gesamt-GS 1,2 µmol/l → normal; sek./prim. Ratio 1,2 → physiologisch; keine toxische Dominanz.
Ergänzende Diagnostik: Mikrobiomanalyse (7α-Dehydroxylase-Aktivität).
Glutaminsäure
Bedeutung / Beschreibung:
Glutaminsäure (Glutamat) ist der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter und Vorstufe von GABA; beteiligt an Energie- und Gehirnstoffwechsel.
Interpretation:
Normbereich (216–441) – balancierter Neurotransmitter- und Energiehaushalt.
Ergänzende Diagnostik:
GABA, Glutamin, Cortisol, Vitamin B6.
Carnitin
Bedeutung / Beschreibung:
Carnitin transportiert Fettsäuren in die Mitochondrien und ist essenziell für die Energieproduktion.
Interpretation:
Mit 22,3 µmol/l im Normbereich (18,2–47,5). Ein Mangel kann zu Muskelschwäche, Müdigkeit und reduzierter Fettverbrennung führen.
Ergänzende Diagnostik:
Acylcarnitin-Profil, Coenzym Q10, Glukose, Laktat, Aminosäurenprofil.
Phenylalanin
Bedeutung / Beschreibung:
Aminosäure, Vorstufe von Tyrosin, Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin – wichtig für Stimmung, Antrieb und Konzentration.
Interpretation:
Mit 50 µmol/l im Normbereich (30–60). Zu hohe Werte können auf Leberfunktionsstörungen oder Phenylketonurie hindeuten, zu niedrige auf unzureichende Proteinzufuhr.
Ergänzende Diagnostik:
Tyrosin, Tryptophan, Leberparameter (ALT, AST), Neurotransmitterprofil.
Tyrosin
Bedeutung / Beschreibung:
Aminosäure und Ausgangsstoff für Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin und Schilddrüsenhormone.
Interpretation:
Normbereich (29–68) – grenzwertig niedrig, was auf erhöhten Verbrauch durch Stress oder unzureichende Eiweißzufuhr hinweisen kann.
Ergänzende Diagnostik:
Phenylalanin, TSH, Cortisol, Dopaminmetaboliten (HVA), Ernährungsanalyse.
Valin
Bedeutung / Beschreibung:
Essenzielle verzweigtkettige Aminosäure (BCAA), wichtig für Muskelaufbau, Energie und Geweberegeneration.
Interpretation:
Mit 200,5 µmol/l im Normbereich (105–208). Stabiler Aminosäurenstatus. Zu niedrige Werte deuten auf katabole Stoffwechsellage hin.
Ergänzende Diagnostik:
Leucin, Isoleucin, Gesamt-BCAA, Harnstoffzyklusparameter.
Cholin
Bedeutung / Beschreibung:
Cholin ist eine essenzielle Substanz für die Bildung von Zellmembranen und Neurotransmittern (z. B. Acetylcholin). Es unterstützt Leberfunktion, Gedächtnis und Fettstoffwechsel.
Interpretation:
Mit 66,0 µmol/l im Normbereich (19,7–72) – gute Versorgung. Ein Mangel kann zu Konzentrationsschwäche, Fettleber oder Muskelschwäche führen.
Ergänzende Diagnostik:
Betain (Oxidationsprodukt von Cholin), Homocystein, Leberwerte (GPT, GOT).
Histidin
Bedeutung / Beschreibung:
Histidin ist eine semi-essenzielle Aminosäure, Vorstufe von Histamin und wichtig für Immunfunktion, Wundheilung und pH-Regulation.
Interpretation:
Mit 80 µmol/l im Normbereich (42–89). Eine ausreichende Versorgung spricht gegen eine Histaminintoleranz.
Ergänzende Diagnostik:
Histamin, DAO (Diaminoxidase), Vitamin B6.
Histamin
Bedeutung / Beschreibung:
Histamin ist ein biogenes Amin, das bei Entzündungen, Allergien und in der Magensäuresekretion eine Rolle spielt.
Interpretation:
Referenz 0,4–0,92. Dies spricht für eine Histaminintoleranz oder gesteigerte Mastzellaktivität. Symptome können Hautrötungen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden oder Schlafstörungen sein.
Ergänzende Diagnostik:
DAO-Aktivität, Vitamin B6, Methylhistamin im Urin, Mastzellaktivität (Tryptase).
GABA (Gamma-Aminobuttersäure)
Bedeutung / Beschreibung:
GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im Gehirn und wirkt entspannend, angstlösend und schlaffördernd.
Interpretation:
Referenz 0,32–0,95. Hinweis auf Stress, Schlafmangel oder Dysbalance im Neurotransmitterhaushalt.
Ergänzende Diagnostik:
Glutamat/GABA-Ratio, Cortisol, Serotonin, Vitamin B6 (Kofaktor der GABA-Synthese).
Isoleucin
Bedeutung / Beschreibung:
Essenzielle Aminosäure (BCAA), wichtig für Muskelwachstum, Regeneration und Blutzuckerregulation.
Interpretation:
Normbereich 32–7). Normale Eiweißzufuhr und Muskelstoffwechsel.
Ergänzende Diagnostik:
Leucin, Valin, Harnstoff, Kreatinin.
Leucin
Bedeutung / Beschreibung:
Essenzielle Aminosäure, stimuliert Muskelaufbau über Aktivierung des mTOR-Signalwegs.
Interpretation:
Normbereich 56–117. Hinweis auf leichten Mehrbedarf, z. B. bei körperlicher Belastung oder Diät.
Ergänzende Diagnostik:
Isoleucin, Valin, Gesamteiweiß, Harnstoffzyklus.
Betain
Bedeutung / Beschreibung:
Betain entsteht aus Cholin und ist wichtig für Methylierungsprozesse, Homocysteinabbau und Zellschutz.
Interpretation:
(Referenz 17–52. Hinweis auf Störung des Methylstoffwechsels oder Leberfunktion. Folgen können erhöhte Homocysteinspiegel, Fettleber und Entzündungen sein.
Ergänzende Diagnostik:
Homocystein, Vitamin B12, Folsäure, Cholin, Leberwerte (GOT, GPT).
Spermidin
Bedeutung / Beschreibung:
Spermidin ist ein Polyamin, das Zellregeneration, Autophagie und Langlebigkeit fördert. Es unterstützt Zellwachstum, Gedächtnisleistung und Herzgesundheit.
Interpretation:
Normbereich (1,7–6,7) – Versorgung ausreichend, aber verbesserungsfähig. Niedrige Werte treten bei Alterungsprozessen oder oxidativem Stress auf.
Ergänzende Diagnostik:
Spermin, Putrescin, oxidative Stressmarker, Ernährung (Spermidinreiche Kost: Weizenkeime, Soja, Pilze).
Citrullin
Bedeutung / Beschreibung:
Citrullin ist eine Aminosäure des Harnstoffzyklus und dient der Entgiftung von Ammoniak; außerdem Vorstufe von Arginin.
Interpretation:
Normbereich (9,4–29,9) – stabil, jedoch an der unteren Grenze. Niedrige Werte können auf intestinale Schleimhautschäden oder geringe Proteinaufnahme hinweisen.
Ergänzende Diagnostik:
Arginin, Ornithin, Ammoniak im Plasma, Leberparameter.
Arginin
Bedeutung / Beschreibung:
Arginin ist eine semi-essenzielle Aminosäure, wichtig für NO-Produktion, Durchblutung, Wundheilung und Immunfunktion.
Interpretation:
Referenz 4,45–27,2. Hinweis auf verminderten NO-Stoffwechsel, eingeschränkte Gefäßfunktion oder hohe Entzündungsaktivität.
Ergänzende Diagnostik:
Citrullin, ADMA, SDMA, Nitrat/Nitrit, Blutdruck, Homocystein.
Threonin
Bedeutung / Beschreibung:
Essenzielle Aminosäure, wichtig für Schleimhautaufbau, Immunabwehr und Kollagenbildung.
Interpretation:
Normbereich (51–123). Leichte Unterversorgung möglich bei erhöhtem Bedarf oder Proteinmangel.
Ergänzende Diagnostik:
Gesamteiweiß, Lysin, Prolin, Verdauungsenzyme, Darmmikrobiom.
Tryptophan
Bedeutung / Beschreibung:
Essenzielle Aminosäure, Vorstufe von Serotonin und Melatonin, wichtig für Stimmung, Schlaf und psychische Stabilität.
Interpretation:
Normbereich (18,5–36). Normaler Status; erniedrigte Werte würden auf Stress, Entzündung oder erhöhte IDO-Aktivität hinweisen.
Ergänzende Diagnostik:
Kynurenin, Serotonin, Vitamin B6, Cortisol, DHEAS.
Kynurenin
Bedeutung / Beschreibung:
Kynurenin entsteht aus Tryptophan über die IDO-Enzymkaskade und steht im Zusammenhang mit Entzündungs-, Immun- und Stressreaktionen.
Interpretation:
Referenz < 1,20. Hinweis auf aktivierte Immunantwort oder chronischen Stress mit gesteigerter IDO-Aktivität. Dies kann den Serotoninspiegel senken und Stimmungseinflüsse begünstigen.
Ergänzende Diagnostik:
Tryptophan, Kynurenin/Tryptophan-Quotient (IDO-Aktivität), Cortisol, CRP, Interleukin-6.
IDO-Aktivität (Kynurenin/Tryptophan-Ratio)
Bedeutung / Beschreibung:
Gibt Aufschluss über das Verhältnis zwischen Tryptophanabbau und Immunaktivität. Ein hoher Wert weist auf Entzündung oder oxidativen Stress hin.
Interpretation:
(Referenz 18–49) deutlich erniedrigt. Das spricht nicht für eine entzündliche Aktivierung. IDO-Aktivität ist inaktiv – Serotoninbildung wahrscheinlich ungestört.
Ergänzende Diagnostik:
Tryptophan, Serotonin, Cortisol, Vitamin B6, Entzündungsmarker (CRP).
Cortisol
Bedeutung / Beschreibung:
Cortisol ist das Haupt-Stresshormon der Nebennierenrinde, reguliert Blutzucker, Entzündungen, Energie und Immunsystem.
Interpretation:
Normbereich (0,06–0,24) – physiologische Ausschüttung. Erhöhte Werte deuten auf Stress oder Entzündung hin, erniedrigte auf Erschöpfung der Nebennieren.
Ergänzende Diagnostik:
Tagesprofil (Speichel-Cortisol), DHEA-S, ACTH, Blutzucker, Schilddrüsenhormone.
DHEA-S (Dehydroepiandrosteronsulfat)
Bedeutung / Beschreibung:
DHEA-S ist ein Steroidhormon der Nebennieren, Gegenspieler von Cortisol, wirkt antioxidativ und beeinflusst Energie, Libido und Stressresilienz.
Interpretation:
Normbereich (0,3–2,8). Ausgewogenes Verhältnis zu Cortisol spricht für gute Stressadaptation.
Ergänzende Diagnostik:
Cortisol/DHEA-Ratio, Testosteron, Estradiol, Vitamin C, Mikronährstoffstatus (Zink, Magnesium).
Hippursäure
Bedeutung / Beschreibung:
Endprodukt des mikrobiellen Stoffwechsels von Polyphenolen und Aromastoffen; Marker für Leberentgiftung und Darmfloraaktivität.
Interpretation:
Normbereich (3–63) – normale Entgiftungsleistung und Mikrobiomaktivität.
Ergänzende Diagnostik:
Benzoesäure, Gallensäuren, Leberparameter (GGT, ALT).
p-Cresol-Sulfat
Bedeutung / Beschreibung:
Ein bakterielles Abbauprodukt von Tyrosin; in hohen Konzentrationen potenziell nierentoxisch und entzündungsfördernd.
Interpretation:
Normbereich (1,24–49,4) – unauffällig. Erhöhte Werte wären Hinweis auf Darmdysbiose oder Leber-/Nierenbelastung.
Ergänzende Diagnostik:
Indoxylsulfat, Kreatinin, Harnstoff, Mikrobiomanalyse.
Indol-3-Essigsäure (IAA)
Bedeutung / Beschreibung:
Tryptophan-Metabolit des Mikrobioms; beeinflusst Entzündungsprozesse und Darmbarriere.
Interpretation:
(Referenz < 1,55) – Hinweis auf Darmdysbiose oder gesteigerte bakterielle Tryptophanverwertung.
Ergänzende Diagnostik:
Tryptophan, Indolpropionsäure, Mikrobiomanalyse (z. B. Darmflora-Sequenzierung).
Indolpropionsäure
Bedeutung / Beschreibung:
Mikrobielles Produkt mit antioxidativer und neuroprotektiver Wirkung.
Interpretation:
Normbereich (0,08–1,28) – gesunde Mikrobiomaktivität.
Ergänzende Diagnostik:
Indol-3-Essigsäure, Indoxylsulfat, oxidativer Stressstatus.
Indoxylsulfat
Bedeutung / Beschreibung:
Ein mikrobielles Tryptophan-Abbauprodukt, das bei Niereninsuffizienz akkumulieren kann; Marker für Darm-Nieren-Achse.
Interpretation:
Normbereich (0,68–4,3) – unauffällig.
Ergänzende Diagnostik:
Kreatinin, Harnstoff, p-Cresol-Sulfat, Mikrobiomstatus.
Putrescin
Bedeutung / Beschreibung:
Ein Polyamin, das beim Proteinabbau durch Darmbakterien entsteht. In hohen Mengen toxisch und Hinweis auf Dysbiose.
Interpretation:
(Referenz < 0,22). Deutet auf vermehrten mikrobiellen Eiweißabbau und Darmdysbalance hin.
Ergänzende Diagnostik:
Spermidin, Spermin, Darmmikrobiomprofil, Leberfunktion.
Alanin
Bedeutung / Beschreibung:
Alanin ist eine glukogene Aminosäure, die in der Leber zu Glukose umgewandelt werden kann und eine wichtige Rolle im Energie- und Blutzuckerstoffwechsel spielt.
Interpretation:
Normbereich (179–411) – ausreichende Energiebereitstellung. Erniedrigte Werte deuten auf Energiemangel oder Proteinunterversorgung hin, erhöhte Werte auf katabole Stoffwechsellage.
Ergänzende Diagnostik:
Asparagin, Glutamin, Blutzucker, Insulin, Laktat.
Asparagin
Bedeutung / Beschreibung:
Asparagin ist an der Proteinsynthese und an der Energiegewinnung im Zitratzyklus beteiligt; zudem wichtig für das Nervensystem.
Interpretation:
Normbereich (31,3–63,5) – unauffälliger Energiestoffwechsel. Erniedrigte Werte können bei Eiweißmangel oder erhöhtem Verbrauch (z. B. Stress) auftreten.
Ergänzende Diagnostik:
Asparaginsäure, Glutamin, Harnstoff, Cortisol.
Asparaginsäure
Bedeutung / Beschreibung:
Aminosäure des Citratzyklus, wichtig für Energieproduktion, Hormonbildung und Neurotransmission.
Interpretation:
Normbereich (30,3–175) – keine Auffälligkeit. Niedrige Werte deuten auf Proteinmangel, hohe auf Zellabbau oder Übersäuerung.
Ergänzende Diagnostik:
Glutamat, Ammoniak, Laktat, pH-Wert.
Glutamin
Bedeutung / Beschreibung:
Glutamin ist die mengenmäßig häufigste Aminosäure im Blut, wichtig für Darm, Immunsystem, Energieproduktion und Wundheilung.
Interpretation:
(Referenz 92–209). Hinweis auf erhöhten Verbrauch durch Stress, Entzündung, Katabolismus oder Tumorstoffwechsel.
Ergänzende Diagnostik:
Ammoniak, Laktat, C-reaktives Protein (CRP), Darmmikrobiom, Gesamtprotein.
Glycin
Bedeutung / Beschreibung:
Glycin wirkt als hemmender Neurotransmitter und ist zentral für Entgiftung (Glutathion), Kollagenbildung und Schlafqualität.
Interpretation:
Normbereich (186–416) – ausreichende Versorgung. Niedrige Werte können auf Entgiftungsstörung, oxidativen Stress oder Leberbelastung hinweisen.
Ergänzende Diagnostik:
Glutathion, Homocystein, Methionin, Leberwerte (ALT, AST).
Lysin
Bedeutung / Beschreibung:
Essenzielle Aminosäure für Kollagen- und Elastinbildung, Gewebereparatur und Immunfunktion.
Interpretation:
Normbereich (36–85) – ausgewogener Proteinstatus.
Ergänzende Diagnostik:
Threonin, Prolin, Vitamin C (Kollagensynthese), Zink.
Prolin
Bedeutung / Beschreibung:
Aminosäure, die für Kollagen, Haut-, Sehnen- und Bindegewebsaufbau erforderlich ist.
Interpretation:
Normbereich (89–228) – keine Auffälligkeit.
Ergänzende Diagnostik:
Lysin, Vitamin C, Hydroxyprolin im Urin (Bindegewebsabbau).
Taurin
Bedeutung / Beschreibung:
Taurin ist eine schwefelhaltige Aminosäure, wichtig für Nervensystem, Herz, Galle, Elektrolythaushalt und antioxidativen Zellschutz.
Interpretation:
(Referenz 96–196). Hinweis auf oxidativen Stress, Leberbelastung, Gallensäure- oder Mitochondrienstörung.
Ergänzende Diagnostik:
Leberwerte (GGT, ALT, AST), Glutathion, Zink, Magnesium, Vitamin B6.
Hormonprofil (Speicheltest)
Der Speicheltest misst die biologisch aktiven, freien Hormone (z. B. Cortisol, DHEA, Testosteron, Progesteron, Östradiol) – also jene, die tatsächlich im Körper wirksam sind.
Er dient zur Beurteilung des Hormonhaushalts, insbesondere bei Erschöpfung, Stress, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Libidoveränderungen oder hormonellen Ungleichgewichten.
Cortisol
Bezeichnung: Cortisol (Speichel)
Bedeutung/Beschreibung: Stresshormon der Nebennierenrinde; steuert u. a. Glukosestoffwechsel, Blutdruck, Entzündungshemmung (tagesrhythmisch).
Interpretation: (Norm 3–9) → im Normbereich. Hinweise: Zu hoch → akuter Stress, Depression, Cushing-Syndrom; zu niedrig → Nebenniereninsuffizienz, chronische Erschöpfung (Kontext nötig).
Ergänzende Diagnostik: Tagesprofil (mehrere Speichelproben), Serum-Cortisol ± ACTH, DHEA-S, ggf. Dexamethason-Suppressionstest.
Progesteron
Bezeichnung: Progesteron (Speichel)
Bedeutung/Beschreibung: Vorstufe von Corticosteroiden/Androgenen; bei Männern in niedrigen Mengen, wirkt u. a. als Neurosteroid.
Interpretation:(Norm 23,8–58) → am oberen Normrand. Klinisch meist unauffällig; deutlich erhöht z. B. unter exogener Gabe.
Ergänzende Diagnostik: Bei Beschwerden: Serum-Progesteron, Anamnese zu Supplementen/Creme, Gesamtkontext mit Estradiol/Testosteron.
Östradiol (E2)
Bezeichnung: Östradiol (Speichel)
Bedeutung/Beschreibung: Potentestes Östrogen; entsteht bei Männern v. a. durch Aromatisierung von Testosteron; beeinflusst Libido, Knochen, Gefäße.
Interpretation: Ergebnis 3,13 pg/ml (Norm 1,5–3,3) → im oberen Normbereich. Erhöht möglich bei vermehrter Aromataseaktivität, Adipositas, Lebererkrankungen oder exogener Zufuhr.
Ergänzende Diagnostik: Serum-E2 (sensitiver Assay), SHBG, Gesamttestosteron + berechnetes freies T, Leberwerte; ggf. Aromatase-Risiken (Medikation, Alkohol, Bauchfett).
Progesteron/Östradiol-Quotient (P/E-Quotient)
Bezeichnung: P/E-Quotient (Speichel) – berechnet
Bedeutung/Beschreibung: Verhältnis von Progesteron zu Östradiol als grobe Balance-Kennzahl.
Interpretation:(Referenz 30–50) → deutlich erniedrigt (= relativ mehr Östrogenwirkung gegenüber Progesteron). Bedeutung hängt stark vom klinischen Kontext ab (z. B. Schlaf, Stimmung, Gewicht, Libido). 4. Ergänzende Diagnostik: Wiederholungskontrolle, Serumwerte (Progesteron, E2), Schilddrüse (TSH, fT3/fT4), Leberstatus, Körperfett/Metabolik (HbA1c, Nüchterninsulin).
DHEA
Bezeichnung: DHEA (Speichel)
Bedeutung/Beschreibung: Nebennieren-Androgenvorstufe; Marker für adrenale Reserve/Stressresilienz.
Interpretation: Ergebnis 202,28 pg/ml (Norm 140–570) → im Normbereich (unteres Mittelfeld). Niedrig: chronischer Stress/Alter; hoch: Supplementation, adrenale Hyperfunktion.
Ergänzende Diagnostik: Serum-DHEA-S (stabiler Marker), Cortisol-Tagesprofil, Anamnese zu DHEA-Präparaten.
Nitrosativer Stress – Zellstressprofil (Urin):
Dieser Test dient zur Beurteilung von oxidativem und nitrosativem Zellstress im Körper. Er zeigt, ob freie Radikale oder Stickstoffverbindungen die Zellen, DNA oder Mitochondrien belasten.
Früherkennung von Zellstress, B12-Stoffwechselstörungen und Darm- bzw. Mitochondrienfunktionsproblemen.
Vorteile:
- Nicht-invasiv (Urinprobe)
- Kombiniert mehrere wichtige Marker
- Liefert Hinweise auf oxidativen Schaden, NO-Belastung und Energie-/Entgiftungsstatus
8-OH-Desoxyguanosin (8-OHdG)
Bedeutung / Beschreibung:
Marker für oxidative DNA-Schädigung; entsteht, wenn freie Radikale DNA-Basen oxidieren. Erhöhte Werte sprechen für erhöhten oxidativen Stress.
Ergebnis:(Referenz: < 9,68) → normal. Interpretation (zu hoch / zu niedrig):
Zu hoch: Oxidativer Stress ↑ (z. B. chronische Entzündung, Rauchen, Umwelttoxine, intensive Belastung).
Zu niedrig: Klinisch unauffällig; sehr niedrige Werte sind meist ohne Relevanz.Ergänzende Diagnostik:
Gesamt-Antioxidantien-Status, GSH/GSSG-Quotient, Coenzym Q10, Vitamin C/E, hs-CRP; Lebensstil-/Expositionsanamnese.
4-Hydroxynitrophenylessigsäure
Bedeutung / Beschreibung:
Urinarer Metabolit, der als Indikator für nitrosativen Stress herangezogen wird (NO/Peroxynitrit-bezogene Prozesse).
Ergebnis: (Referenz: < 4,5) → niedrig/normal.
Interpretation (zu hoch / zu niedrig):
- Zu hoch: Hinweise auf nitrosativen Stress (z. B. chronische Inflammation, Infektionen, mitochondriale Dysfunktion).
- Niedrig/normal: Kein Hinweis auf erhöhte NO/ONOO⁻-Belastung.
Ergänzende Diagnostik:
Nitrotyrosin, NO-Metabolite (Nitrit/Nitrat), Homocystein, BH4/BH2-Balance (indirekt), Entzündungsmarker (hs-CRP), Mitochondrien-Funktionstests.
Methylmalonsäure (MMA)
Bedeutung / Beschreibung:
Funktioneller Marker für Vitamin-B12-Status (Adenosylcobalamin-abhängige Methylmalonyl-CoA-Mutase). Erhöht bei B12-Mangel oder seltener genetischen Enzymdefekten/Niereninsuffizienz.
Ergebnis: 1,78 mg/g Krea (Referenz: < 2,3) → normal.
Interpretation (zu hoch / zu niedrig):
- Zu hoch: Verdacht auf B12-Mangel, renal ↓ Clearance, bakterielle Überwucherung (selten).
- Normal/niedrig: Kein funktioneller B12-Mangel erkennbar.
Ergänzende Diagnostik:
Holotranscobalamin (Holo-TC), Serum-B12, Homocystein, Folat, Nierenfunktion (Krea/eGFR).
Citrullin
Bedeutung / Beschreibung:
Aminosäure des Harnstoffzyklus; dient als Marker für Enterozytenmasse/Dünndarmfunktion (z. B. bei Mukosaschädigung erniedrigt).
Ergebnis:(Referenz: < 4) → normal. (Hinweis: Labor führt als Grenzwert „< 4“; im Kontext wird v. a. Anstieg bewertet.)
Interpretation (zu hoch / zu niedrig):
- Erniedrigt (in Methoden mit unteren Referenzen): mögliche Dünndarmmukosa-Atrophie, Malabsorption.
- Erhöht: selten klinisch relevant; kann bei Harnstoffzyklus-Störungen variieren.
- Citrullin im Urin spiegelt die Aktivität des Harnstoffzyklus wider und zeigt, wie effizient Ammoniak entgiftet wird.
- Erhöhte Werte können auf eine Störung des Harnstoffzyklus, Leberfunktionsschwäche oder vermehrten Proteinabbau hinweisen.
- Niedrige Werte deuten oft auf verminderte Leberleistung, Mangel an Ornithin oder Arginin, oder mitochondriale Dysfunktion hin.
- Citrullin dient in der funktionellen Medizin auch als Marker für Darmgesundheit, da es in den Enterozyten (Dünndarmzellen) gebildet wird – niedrige Werte können Darmschleimhautschäden anzeigen.
- Insgesamt hilft die Citrullin-Bestimmung, Leber-, Darm- und Mitochondrienfunktion ganzheitlich zu beurteilen.
Ergänzende Diagnostik:
Aminosäurenprofil (Arginin, Ornithin), Ammoniak, Harnstoff, Darmdiagnostik (bei Symptomen), Entzündungsmarker.
Kreatinin (Urin, enzymatisch)
Bedeutung / Beschreibung:
Dient hier vor allem zur Kreatinin-Normierung anderer Urinmarker (Konzentrationsschwankungen/Trinkmenge ausgleichen).
Ergebnis:(Referenz: 290–2260) → im Referenzbereich.
Interpretation (zu hoch / zu niedrig):
- Niedrig: Verdünnter Urin (hohe Trinkmenge).
- Hoch: Konzentrierter Urin (geringe Trinkmenge).
Ergänzende Diagnostik:
Bei Auffälligkeiten: Serum-Kreatinin/eGFR, Urinstatus.
Der BASIS-DARM-Test (mit Akkermansia-Profil)
untersucht die Zusammensetzung und Funktion der Darmflora, Verdauungsleistung und Darmschleimhaut-Barriere.
Sinn des Tests:
Er dient zur Beurteilung der Darmgesundheit, Verdauung und Immunabwehr. Damit lassen sich Dysbiosen, Fehlbesiedlungen, Verdauungsschwächen, Schleimhautstörungen oder entzündliche Prozesse frühzeitig erkennen.
Vorteile:
- Ganzheitlicher Überblick über Mikrobiota, Verdauungsrückstände, Entzündung und Barrierefunktion
- Erkennt Überwuchs oder Mangel nützlicher Bakterien (z. B. Bifidobakterien, Akkermansia)
- Liefert Hinweise auf Nahrungsverwertung, Leaky-Gut-Risiko und Immunstatus
- Unterstützt Therapieplanung bei Verdauungsbeschwerden, Nahrungsunverträglichkeiten, Haut- oder Stoffwechselproblemen.
Kurz gesagt:
👉 Der Test zeigt, wie gut der Darm funktioniert, ob die Flora im Gleichgewicht ist und ob die Darmschleimhaut gesund bleibt – eine wichtige Basis für Verdauung, Immunsystem und allgemeines Wohlbefinden.
Aerobe Bakterien
Bezeichnung: Escherichia coli
Bedeutung: Leitkeim, Marker für Darmökologie.
Interpretation: 1,0×10⁷ KBE/g — oberes Normende (Ref. 10⁶–10⁷). 4) Ergänzende Diagnostik: Bei Beschwerden: Dysbiose-Profil im Verlauf, Ernährung/Präbiotika prüfen.
Bezeichnung: Klebsiella spp.
Bedeutung: Potenzieller Pathobiont/Opportunist.
Interpretation: 1,0×10⁷ KBE/g — deutlich erhöht (Ref. <10⁴). Hinweis auf Dysbiose/Überwuchs. 4) Ergänzende Diagnostik: Verlaufskontrolle, Antibiotikavorgeschichte, ggf. erweiterte Keim-Diagnostik/Resistogramm bei klinischer Relevanz.
Bezeichnung: Enterococcus spp.
Bedeutung: Kommensale Milchsäurebakterien.
Interpretation: <1,0×10⁴ KBE/g — deutlich erniedrigt (Ref. 10⁶–10⁷). 4) Ergänzende Diagnostik: Ernährung (Ballaststoffe), Pro-/Synbiotika-Strategie erwägen; Verlauf.
Bezeichnung: Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Hafnia spp.
Bedeutung: Opportunisten.
Interpretation: alle niedrig/<Nachweisgrenze — im Zielbereich.
Ergänzende Diagnostik: Verlaufskontrolle, Antibiotikavorgeschichte, ggf. erweiterte Keim-Diagnostik/Resistogramm bei klinischer Relevanz.
Anaerobe Bakterien
Bezeichnung: Bifidobacterium spp.
Bedeutung: Schlüsselmikrobiota (Fermentierer, SCFA).
Interpretation: (Ref. 10⁹–10¹¹).
Ergänzende Diagnostik: Präbiotische Ballaststoffe (Inulin/Fructane je nach Verträglichkeit), Verlaufskontrolle.
Bezeichnung: Bacteroides spp.
Bedeutung: Dominate Anaerobier, Protein-/Fettabbau.
Interpretation: Normbereich (10⁹–10¹¹), eher unteres Normdrittel.
Ergänzende Diagnostik: Ballaststoffqualität prüfen; Verlauf.
Bezeichnung: Lactobacillus spp.
Bedeutung: Milchsäurebildner, pH-Stabilisierung.
Interpretation: (Ref. 10⁵–10⁷).
Ergänzende Diagnostik: Fermentierte Lebensmittel/gezielte Probiotika testen; Verlauf.
Bezeichnung: Clostridium spp. (gesamt)
Bedeutung: Heterogene Gruppe.
Interpretation: <1,0×10⁵ KBE/g — im Zielbereich (Ref. <10⁵). 4) Ergänzende Diagnostik: Keine, sofern asymptomatisch.
Mykologie
- Candida spp. – Sammelbegriff für verschiedene Candida-Arten
- Candida albicans – häufigste pathogene Candida-Art
- chimmel – z. B. Aspergillus, Penicillium, Mucor
- Geotrichum – Hefeart, teils pathogen bei Immunsuppression
Bedeutung
- Es handelt sich um opportunistische Erreger, d. h. sie verursachen meist nur bei geschwächtem Immunsystem oder gestörter Barrierefunktion Infektionen.
- Candida albicans: typischerweise Schleimhautinfektionen (Mund, Genital, Darm)
- Geotrichum: selten, aber bei Immunschwäche möglich
- Schimmelpilze: inhalativ → Lunge, systemisch → gefährlich bei Immunsuppression
Interpretation
- Negativ/unter Grenzwert = unauffällig, kein Hinweis auf pathogene Mykosen aktuell
- Normale Besiedelung ist möglich, insbesondere bei Hefen im Darm4) Ergänzende Diagnostik (bei Verdacht auf relevante Pilzbelastung oder Immunschwäche)
Wenn eine klinische Relevanz vermutet wird (z. B. rezidivierende Infekte, chronische Beschwerden, unklare Symptome), sind folgende
Diagnostikschritte sinnvoll:
A) Immunstatus prüfen
- Differenzierte Blutbildanalyse
- Leukozyten, Lymphozytensubgruppen (CD4/CD8), Neutrophile, Monozyten
- Immunglobuline (IgA, IgG, IgM, IgE)
- Zytokinstatus (z. B. IL-6, TNF-α)
Hinweis auf Entzündungsaktivität oder Dysregulation
- T-Zell-Funktionstests (bei unklarer Immunschwäche)
B) Darm-Mikrobiom & Schleimhautbarriere (bei Candida-Befund im Stuhl) - Mikrobiomanalyse (Stuhl)
- Zusammensetzung, Diversität, Hefebelastung, kurzkettige Fettsäuren
- Zonulin (Stuhl/Serum)
- Marker für intestinale Permeabilität („Leaky Gut“)
- sIgA (sekretorisches IgA im Stuhl)
- Immunabwehr in der Schleimhaut
C) Spezifische Pilzdiagnostik (bei klinischem Verdacht) - Pilz-PCR oder Kultur (je nach Lokalisation – Stuhl, Vaginalabstrich, Sputum, etc.)
- (1,3)-β-D-Glucan im Serum
- Marker für systemische Pilzinfektionen (v. a. bei Schimmel)
- Aspergillus-Antigen (Galactomannan)
bei V. a. invasive Aspergillose Wann ist ergänzende Diagnostik besonders sinnvoll?
- Rezidivierende Infekte (v. a. Candida)
- Chronische Müdigkeit, „Brain Fog“, Hautprobleme, Verdauungsbeschwerden
- Antibiotika-Vorgeschichte → gestörtes Mikrobiom
- Autoimmunerkrankungen
- Immunsuppressive Therapien (Kortison, Chemotherapie)
- Diabetes mellitus
pH-Wert des Stuhls
Bezeichnung
pH-Wert im Stuhl → misst, ob der Darminhalt eher sauer oder alkalisch ist.
Bedeutung
- Der pH spiegelt das mikrobiologische Fermentationsverhalten wider:
- Sauerer pH (5,5–6,5) → Zeichen einer gesunden Kohlenhydratfermentation durch Milchsäure- und Bifidobakterien (z. B. Bildung von kurzkettigen Fettsäuren wie Butyrat, Acetat).
- Alkalischer pH (>7,0) → weist eher auf vermehrte Eiweißabbauprozesse (Proteolyse) und eine Verschiebung zu fäulnisaktiver Flora hin.
Interpretation
- Dein Wert: 7,3 → leicht alkalisch, oberhalb des Referenzbereichs (5,8–6,5).
- Mögliche Ursachen:
- Geringe Ballaststoffzufuhr → weniger pflanzliche Fasern für die „guten“ Darmbakterien.
- Hoher Eiweißanteil (z. B. Fleisch, Shakes) → fördert fäulnisaktive Keime (Clostridien, Bacteroides).
- Verminderte Kohlenhydratfermentation → weniger Milchsäureproduktion → pH steigt.
- Antibiotikatherapie oder dysbiotische Flora nach Stress/Erkrankung.
Konsistenz und Farbe des Stuhls
Bezeichnung
Visuelle Einschätzung vonKonsistenz(fest, weich, breiig, flüssig) undFarbe(braun, hellbraun, dunkel, grau, grün, schwarz, gelb).
Bedeutung
Diese Eigenschaften geben Hinweise auf:
- Verdauungsleistung (Fettverwertung, Gallensäurefluss)
- Transportzeit im Darm
- Ernährungsweise
- Mögliche Pathologien (Malabsorption, Gallestau, Blutungen etc.)
Interpretation
- Breiig, hellbraun → meist unspezifisch, häufig funktionell oder ernährungsbedingt.
- Hellbraun: normale bis etwas schnellere Darmpassage, geringerer Galleinfluss.
- Breiig: kann auf mehr Wassergehalt im Stuhl hinweisen (z. B. bei ballaststoffreicher oder fettreicher Ernährung, leichter Maldigestion oder Stress).
Bei Einmalbefund ohne Beschwerden→nicht pathologisch.
Bei chronisch breiigem Stuhl→ Ursachen wieNahrungsmittelintoleranzen (Laktose, Fruktose, FODMAPs), Gallensäure verlust, Pankreasinsuffizienz oder Reizdarmsyndrom prüfen.
Verdauungsrückstands-Untersuchung
Quantitatives Fett im Stuhl
Bezeichnung: Quant. Fett im Stuhl
Bedeutung: Gibt Auskunft über die Fettverdauung und Fettaufnahme im Darm.→ Vor allem wichtig, um Störungen der Fettresorption (z. B. durch Darmerkrankungen) oder eine Pankreasinsuffizienz (Bauchspeicheldrüsen-Schwäche) zu erkennen.
Interpretation:
(Referenz: < 3,5 g/100 g)→ Das bedeutet: Es ist etwas mehr Fett im Stuhl als normal, also eine minimale Fettmaldigestion oder -malabsorption.→ Dies nennt man subtile Steatorrhoe (milde Fettstühle, oft noch ohne sichtbare Fettauflagerungen).
Mögliche Ursachen:
- leicht verminderte Pankreaselastase (Bauchspeicheldrüse produziert zu wenig Verdauungsenzyme)
- zu fettreiche Ernährung oder bestimmte Fettarten (z. B. MCT- oder Omega-3-reiche Nahrung)• schneller Darmpassage (z. B. bei Reizdarm, Infekten)
- Gallensäuremangel oder -verlust (bei Galleproblemen)
Ergänzende Diagnostik:→ Ernährungstagebuch (Fettmenge/-art prüfen)→ Kontrolle im Verlauf→ Wenn Beschwerden bestehen: Pankreas-Elastase im Stuhl oder 72h-Fettbilanz zur genaueren Quantifizierung.
Quantitativer Zucker im Stuhl
Bezeichnung: Quant. Zucker im Stuhl
Bedeutung: Misst nicht „Haushaltszucker“, sondern nicht resorbierte Kohlenhydrate (v. a. Disaccharide oder Monosaccharide).→ Hinweis auf eine Kohlenhydratmalabsorption (z. B. Laktose-, Fruktose- oder Sorbitunverträglichkeit).
Interpretation:(Ref.: < 2,5 g/100 g)→ Es bleiben mehr Zuckerreste im Stuhl als üblich. → Diese werden im Dickdarm durch Bakterien fermentiert, was zu Gasbildung, Blähungen, Durchfällen oder Bauchschmerzen führen kann.
Mögliche Ursachen:
- Laktoseintoleranz (Milchzucker wird nicht vollständig abgebaut)
- Fruktosemalabsorption
- zu hoher Anteil fermentierbarer Kohlenhydrate (FODMAPs)
- schnelle Darmpassage oder Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO)
Ergänzende Diagnostik:→ H₂-Atemtests (für Laktose, Fruktose, Sorbit)→ ggf. FODMAP-Ernährungsanalyse→ ggf. Stuhlfloraanalyse bei chronischen Beschwerden
Quantitativer Stickstoff und Wasser
Bezeichnung: Quant. Stickstoff, Wasser
Bedeutung:
- Stickstoff: Maß für Eiweißabbauprodukte im Stuhl → zeigt, ob Eiweiß schlecht verdaut oder nicht aufgenommen wird (z. B. bei Entzündungen, Maldigestion).
- Wasser: Gibt Aufschluss über den Wassergehalt des Stuhls → relevant bei Durchfällen oder Verstopfung.
Interpretation:
- Stickstoff: 0,50 g/100 g – normal (< 1,0)
- Wasser: 80 g/100 g – normal (75–85)→
Das bedeutet: Eiweißverdauung ist normal, keine Hinweise auf Malabsorption oder Entzündung.→ Auch der Stuhl-Wassergehalt ist physiologisch, also weder Durchfall noch zu trockener Stuhl.
Ergänzende Diagnostik:→ Keine erforderlich, da unauffällig.
Gesamtbewertung:
Leicht erhöhte Fett- und Zuckerrückstände deuten auf eine milde Verdauungsschwäche hin — eventuell durch:
kurzfristige Ernährungsfaktoren (z. B. fettreiche, ballaststoffarme oder FODMAP-reiche Mahlzeiten),
- funktionelle Störungen (Reizdarm mit schneller Passage),
- oder beginnende Enzymmangelzustände (z. B. Pankreas, Laktase).
Wenn du Beschwerden wie Blähungen, Fettstuhl, Durchfall oder Völlegefühl hast, wäre eine gezielte weiterführende Diagnostik sinnvoll.
Maldigestion - Pankreaselastase/Gallensäuren
Pankreaselastase
Bedeutung:
Die Pankreaselastase ist ein Enzym, das ausschließlich von der exokrinen Bauchspeicheldrüse (Pankreas) produziert wird und über den Stuhl ausgeschieden wird. Sie dient als Marker für die exokrine Pankreasfunktion, also die Fähigkeit des Pankreas, Verdauungsenzyme bereitzustellen.
Interpretation:
(>200 µg/g)
→ Der Wert liegt im Normbereich und spricht für eine normale exokrine Pankreasfunktion.
- >200 µg/g: normale Funktion
- 100–200 µg/g: milde bis mäßige Insuffizienz
- <100 µg/g: schwere exokrine Pankreasinsuffizienz
Kommentar:
Ein normaler Wert schließt eine relevante Pankreasinsuffizienz als Ursache einer Maldigestion praktisch aus.
Ergänzende Diagnostik:
Nur bei klinischem Verdacht oder Verlaufskontrolle (z. B. neu auftretende Fettstühle, Gewichtsverlust, chronische Diarrhoe) sollte die Untersuchung wiederholt oder ergänzt werden (z. B. durch bildgebende Verfahren wie Sonografie oder MRCP).
Gallensäuren (Stuhl)
Bedeutung:
Die Bestimmung der Gallensäuren im Stuhl dient zur Beurteilung eines Gallensäureverlustsyndroms oder einer gestörten Gallensäureresorption im terminalen Ileum.
Gallensäuren sind wichtig für die Fettverdauung; eine gestörte Rückresorption kann zu chronischem Durchfall und Fettstühlen führen.
Interpretation:
(<70 µmol/l)
→ Der Wert liegt im Normbereich und spricht gegen einen Gallensäureverlust oder eine Resorptionsstörung.
Kommentar:
Ein normaler Stuhl-Gallensäurewert schließt eine Gallensäuremalabsorption weitgehend aus, besonders wenn klinisch keine chronische Diarrhoe oder Fettmalabsorption besteht.
Ergänzende Diagnostik:
Bei anhaltendem chronischem Durchfall und weiter bestehendem klinischen Verdacht kann ergänzend eine funktionelle
Diagnostik erfolgen:
- SeHCAT-Test (nuklearmedizinisch, misst Gallensäurerückresorption)
- Serum-C4-Bestimmung (Marker für Gallensäuresynthese in der Leber)Gesamtbewertung:
Beide Parameter (Pankreaselastase und Gallensäuren im Stuhl) liegen im Normbereich.
→ Kein Hinweis auf Maldigestion oder Malabsorption durch Pankreasinsuffizienz oder Gallensäureverlust.
Falls jedoch weiterhin klinische Beschwerden wie Blähungen, Diarrhoe oder Gewichtsverlust bestehen, sollte ergänzend eine Abklärung anderer Ursachen erfolgen, z. B.: - Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO Atemtest)
- Zöliakie (Serologie: Transglutaminase-AK, IgA)
- Laktose- / Fruktoseintoleranz
- Mikroskopische Kolitis
Malabsorption / Entzündung
Die Tests auf Calprotectin und Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl dienen zur Beurteilung von Entzündung und Barrierefunktion der Darmschleimhaut.
- Calprotectin zeigt an, ob eine entzündliche Aktivität im Darm besteht (z. B. bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Infektionen).
- Alpha-1-Antitrypsin prüft, ob Eiweiß über die Darmschleimhaut verloren geht oder die Darmbarriere geschädigt ist.
Calprotectin (Stuhl)
Bedeutung:Calprotectin ist ein Protein, das überwiegend in neutrophilen Granulozyten vorkommt. Es dient als sensitiver Marker für entzündliche Prozesse in der Darmschleimhaut. Erhöhte Werte sprechen für eine Aktivierung des Immunsystems im Gastrointestinaltrakt, wie sie bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) oder infektiösen Enteritiden auftreten kann.
Ergebnis / Interpretation: normal (< 50 mg/l).Der gemessene Wert liegt im Normbereich. Damit besteht kein Hinweis auf eine relevante entzündliche Aktivität der Darmschleimhaut zum Untersuchungszeitpunkt.
Ergänzende Diagnostik / Empfehlung:Bei persistierenden gastrointestinalen Symptomen (z. B. Diarrhö, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust) kann eine Verlaufskontrolle sinnvoll sein, um Veränderungen im Entzündungsgeschehen frühzeitig zu erkennen.
Bei klinischem Verdacht auf entzündliche Darmerkrankung ggf. weiterführende Diagnostik (z. B. Koloskopie, CRP-Bestimmung).
Alpha-1-Antitrypsin (Stuhl)
Bedeutung:Alpha-1-Antitrypsin ist ein im Serum vorkommendes Protein, das bei intakter Darmschleimhaut kaum in den Stuhl übertritt. Es dient als Marker für eine gestörte intestinale Barrierefunktion oder für Proteinverluste über den Darm (enterale Proteinverlust-Syndrome).
Ergebnis / Interpretation:(< 27,5 mg/dl). Der Wert liegt im Normbereich. Es besteht kein Hinweis auf eine erhöhte intestinale Permeabilität oder einen relevanten enteralen Proteinverlust.
Ergänzende Diagnostik / Empfehlung:
Bei persistierenden Symptomen oder Verdacht auf Malabsorptionssyndrom kann eine Verlaufskontrolle oder ergänzende Diagnostik (z. B. Elastase im Stuhl, Pankreasfunktionstests, H2-Atemtests) erwogen werden.
Schleimhautimmunität & Barriere
Bezeichnung: sIgA (sekretorisches Immunglobulin A)
Bedeutung:
Sekretorisches IgA ist der wichtigste Antikörper der mukosalen Immunabwehr. Es wird von Plasmazellen in der Lamina propria gebildet und über Epithelzellen in das Darmlumen sezerniert.
sIgA bindet an Antigene, Mikroorganismen und Toxine und verhindert so deren Adhärenz an die Mukosa („immune exclusion“). Es dient somit als zentraler Marker der mukosalen Immunkompetenz.
Interpretation:
Wert:(Referenz: 510–2040 µg/ml).
→ Hinweis auf eine intakte sekretorische Immunabwehr der Darmschleimhaut.
Ergänzende Diagnostik:
Eine Verlaufskontrolle ist nur bei klinischen Beschwerden (z. B. rezidivierende Infekte, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Nahrungsmittelintoleranzen) erforderlich. Bei persistierend erniedrigten oder stark erhöhten Werten sollte eine erweiterte immunologische oder mikrobiologische Diagnostik erfolgen.
Zonulin (Stuhl)
Bedeutung:
Zonulin ist ein physiologischer Regulator der Tight Junctions im intestinalen Epithel. Es kontrolliert die Durchlässigkeit der epithelialen Barriere.
Erhöhte Zonulinspiegel werden als Hinweis auf eine erhöhte intestinale Permeabilität(„Leaky-gut-Syndrom“) interpretiert und können bei verschiedenen entzündlichen, autoimmunen oder metabolischen Erkrankungen vorkommen.
Interpretation:
Wert: (Referenz: < 55 ng/ml).
→ Es zeigen sich keine Hinweise auf eine gestörte Barrierefunktion der Darmschleimhaut.
Ergänzende Diagnostik:
Bei persistierender klinischer Symptomatik (z. B. Blähungen, Diarrhö, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, chronische Entzündung) kann eine ergänzende Beurteilung weiterer Barriere- oder Entzündungsmarker (z. B. Alpha-1-Antitrypsin, Calprotectin, Lipopolysaccharid-bindendes Protein im Serum) sinnvoll sein.
Histamin (Stuhl)
Histamin ist ein biogenes Amin, das im Körper als Botenstoff wirkt – unter anderem im Immunsystem, im Nervensystem und im Magen-Darm-Trakt.
Es wird sowohl vom Körper selbst gebildet (z. B. in Mastzellen) als auch durch bestimmte Bakterien im Darm produziert.
Bedeutung:
Ein erhöhter Histaminwert im Stuhl kann auf eine Histaminbelastung oder eine mikrobielle Dysbiose (Ungleichgewicht der Darmflora) hinweisen.
- Einige Darmbakterien (z. B. Morganella, Proteus, Klebsiella, Enterobacter) produzieren Histamin.
- Bei Stress, Darmentzündungen, erhöhter Durchlässigkeit der Darmwand (Leaky Gut) oder einer unausgeglichenen Ernährung kann die lokale Histaminproduktion steigen.
- Außerdem kann ein Mangel an histaminabbauenden Enzymen (z. B. Diaminoxidase – DAO) die Situation verschlechtern.
Interpretation:
Normwert: < 200 ng/ml → niedrig/normal
- Ein Wert unterhalb dieser Grenze spricht nicht für eine relevante Histaminbelastung.
- Werte über 200 ng/ml können auf eine erhöhte Aktivität histaminbildender Darmbakterien oder eine verminderte Abbaukapazität hinweisen.
In manchen Laboren wird eine Erhöhung bis etwa 950 ng/ml als milde bis moderate Belastung bezeichnet, während Werte darüber deutlich erhöht sind.
Die genaue Bewertung hängt jedoch vom Labor und der klinischen Symptomatik ab.
Ergänzende Diagnostik:
Eine isolierte Messung im Stuhl reicht zur Diagnosestellung meist nicht aus.
Sinnvolle ergänzende Untersuchungen (nur bei entsprechenden Symptomen wie Kopfschmerzen, Hautrötung, Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit etc.) sind:
- DAO-Aktivität im Blut (Serum):→ Erniedrigte Werte sprechen für eine eingeschränkte Fähigkeit, Histamin aus der Nahrung abzubauen.
- Histamin im Plasma oder Urin:→ Gibt Hinweise auf die systemische (gesamtkörperliche) Histaminbelastung.
- Darmfloraanalyse (Mikrobiom):→ Kann zeigen, ob histaminbildende Bakterien überrepräsentiert sind.
- Ernährungsanamnese:→ Häufig führen histaminreiche Nahrungsmittel (z. B. Rotwein, Käse, Wurst, Fischkonserven, Tomaten, Spinat) und Lebensmittelreaktion (IGG Test) zu Beschwerden.
- Stressdiagnostik:→ Chronischer Stress kann Mastzellen aktivieren und die Histaminausschüttung steigern.
Mucin- / Butyratbildung
Faecalibacterium prausnitzii
Bezeichnung: Faecalibacterium prausnitzii
Bedeutung:
- Einer der wichtigsten Butyratbildner im menschlichen Darm.
- Butyrat (Buttersäure) ist eine kurzkettige Fettsäure, die als Hauptenergielieferant für die Darmepithelzellen (Kolonozyten) dient.
- Wirkt entzündungshemmend (antiinflammatorisch) durch die Hemmung von NF-κB-Signalwegen und Förderung regulatorischer T-Zellen.
- Ein hoher Anteil steht in Verbindung mit einer intakten Darmschleimhaut, geringerer Entzündungsneigung und besserer metabolischer Balance.
Interpretation:
- Referenzbereich: > 5,0 × 10¹⁰ KBE/g
- Bewertung: Sehr gut – oberhalb der Referenz.→ Hinweis auf eine stabile Butyratproduktion und ein günstiges mikrobielles Milieu.
Ergänzende Diagnostik / Empfehlungen:
- Ballaststoffvielfalt erhalten: Unterschiedliche Pflanzenfasern fördern die mikrobielle Diversität.
- Besonders förderlich: resistente Stärke (z. B. abgekühlte Kartoffeln/Reis), Inulin, Pektine, Hafer-β-Glucane.
- Chronische Entzündungen (z. B. IBD, Reizdarm mit Entzündungstendenz) im Verlauf weiter beobachten.
- Bei Antibiotikatherapie Rückgang möglich – ggf. präventive Ernährung oder probiotische Unterstützung erwägen.
Akkermansia muciniphila
Bezeichnung: Akkermansia muciniphila
Bedeutung:
- Ein zentraler Vertreter der Mucinschicht-assoziierten Bakterien.
- Baut Mucin (Bestandteil der Darmschleimhaut) kontrolliert ab und stimuliert zugleich die Schleimneubildung – wichtig für Schleimhautintegrität und Barrierefunktion.
- Hat günstige Effekte auf Stoffwechsel, Körpergewicht, Blutzuckerregulation und Entzündungsbalance.
- Verminderte Konzentrationen werden mit Adipositas, Typ-2-Diabetes, Fettleber und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen in Verbindung gebracht.
Interpretation:
- Referenzbereich: > 1,5 × 10¹⁰ KBE/g
- Bewertung: Leicht erniedrigt – Hinweis auf mögliche Einschränkung der Schleimhautbarriere oder geringere Mucinschichtaktivität.
Ergänzende Diagnostik / Empfehlungen:
Polyphenolreiche Kost: z. B. Beeren, grüner Tee, Granatapfel, Trauben, Rotkohl.
Präbiotika: Inulin, Fructooligosaccharide (FOS), resistente Stärke fördern Akkermansia.
Fastenperioden oder moderate Kalorienreduktion können die Population fördern.
Vermeidung von übermäßigem Zucker, gesättigten Fetten und Alkohol, da diese Akkermansia hemmen können.
Verlaufskontrolle nach ca. 3–6 Monaten empfohlen, v. a. bei klinischen Beschwerden (z. B. Schleimhautreizungen, Blähungen, Dysbiosezeichen).
Zusammenfassung der mikrobiologischen Situation:
- Butyratproduktion: sehr gut ausgeprägt → entzündungshemmendes, schützendes Milieu.
- Mucinschichtstabilität: leicht beeinträchtigt → Ansatzpunkt für ernährungs- und lebensstilbezogene Optimierung.
Cortisol-Tagesprofil im Speichel
Cortisol ist das wichtigste Stresshormon des Körpers, gebildet in der Nebennierenrinde. Es zeigt den Tagesrhythmus der Nebennierenaktivität – normalerweise morgens hoch und abends niedrig. Die Speichelmessung zeigt die biologisch aktive (freie) Cortisolfraktion.
Cortisol-Tagesprofil im Speichel
Bedeutung / Beschreibung
Cortisol ist das wichtigste Glukokortikoid (Stresshormon) des Körpers und wird in der Nebennierenrinde (Zona fasciculata) gebildet.
Es wird über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse) reguliert:
- Der Hypothalamus schüttet CRH (Corticotropin-Releasing-Hormon) aus.
- Dieses stimuliert die Hypophyse zur Freisetzung von ACTH (Adrenocorticotropes Hormon).
- ACTH regt dann die Nebennierenrinde zur Cortisolproduktion an.
Cortisol zeigt einen deutlichen Tagesrhythmus („zirkadianer Rhythmus“):
- Morgens (kurz nach dem Aufwachen) ist der Spiegel am höchsten, um den Körper zu aktivieren.
- Mittags fällt er langsam ab.
- Abends / nachts ist der Wert am niedrigsten, damit der Körper zur Ruhe kommen kann.
Speichelmessung ist besonders aussagekräftig, weil sie nur das freie, biologisch aktive Cortisol misst – also die Menge, die tatsächlich im Gewebe wirkt (im Gegensatz zum Gesamtkortisol im Serum, das auch an Transportproteine gebunden ist).
Cortisolwerte – hoch oder niedrig:
Ein erhöhter Cortisolspiegel bedeutet, dass der Körper unter Stress oder Belastung steht – entweder akut (kurzzeitig) oder chronisch (langfristig).
Cortisol wird in Stresssituationen ausgeschüttet, um Energie bereitzustellen und den Körper „kampffähig“ zu machen.
Mögliche Ursachen:
- Psychischer oder körperlicher Stress
- Schlafmangel oder unregelmäßiger Schlaf
- Überforderung, Dauerbelastung, Angstzustände
- Entzündungen, Infekte, Schmerz
- Überfunktion der Nebennieren (z. B. Cushing-Syndrom)
- Bestimmte Medikamente (z. B. Kortisonpräparate)
Wirkungen eines dauerhaft zu hohen Cortisolspiegels:
- Erhöhter Blutzucker und Heißhunger (v. a. auf Süßes)
- Gewichtszunahme (vor allem am Bauch)
- Erhöhte Blutdruckwerte
- Schlafstörungen und Unruhe
- Konzentrationsprobleme, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen
- Abgeschwächtes Immunsystem (Infektanfälligkeit)
- Muskelabbau, dünnere Haut, verlangsamte Wundheilung
- Zyklusstörungen bei Frauen, Libidoverlust
Kurzfristig ist ein erhöhter Cortisolwert normal und sogar lebenswichtig, z. B. morgens beim Aufwachen oder bei akuter Anstrengung.
Dauerhaft hohe Werte hingegen sind ungesund und führen zu Erschöpfung und Regulationsstörungen.
Wenn Cortisol zu niedrig ist:
Ein niedriger Cortisolspiegel bedeutet, dass der Körper zu wenig Stresshormon produziert oder dass die Nebennieren erschöpft bzw. unteraktiv sind.
Dies kann nach längeren Stressphasen auftreten, wenn die Nebennieren „ausgebrannt“ sind und nicht mehr genug Cortisol bereitstellen können.
Mögliche Ursachen:
- Chronischer Stress über lange Zeit → „Erschöpfung der Nebennieren“
- Unterfunktion der Nebennieren (Addison-Krankheit)• Störung in der Hypophyse (zu wenig ACTH)
- Längere Kortisontherapie (Unterdrückung der Eigenproduktion)
- Unterzuckerung oder sehr restriktive Diäten
- Schlafmangel oder anhaltende Erschöpfung
Wirkungen eines zu niedrigen Cortisolspiegels: - Starke Müdigkeit und Antriebslosigkeit
- Niedriger Blutdruck, Schwindel beim Aufstehen
- Niedriger Blutzucker, Zittern, Schwächegefühl
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Depressive Verstimmung, Gereiztheit
- Geringe Stresstoleranz („Kleinigkeiten stressen schnell“)
- Vermehrte Entzündungsneigung, schwaches Immunsystem
Ein zu niedriger Cortisolwert bedeutet, dass der Körper nicht mehr ausreichend auf Belastungen reagieren kann – die Stressresistenz ist reduziert, und Betroffene fühlen sich oft ausgelaugt oder „leer“.
Ergänzende Diagnostik (zur Ursachenabklärung Cortisol-Tagesprofil)
Ergänzende Diagnostik (zur Ursachenabklärung)
- DHEA im Speichel oder Serum → Verhältnis zu Cortisol zeigt Balance zwischen „Stress- und Regenerationshormonen“.
- ACTH im Serum → zeigt, ob die Steuerung durch die Hypophyse korrekt funktioniert.
- Cortisol-Aufwachreaktion (CAR-Test) → misst den Anstieg innerhalb der ersten 30–45 Minuten nach dem Aufwachen, sehr sensibel für Stressregulation.
- Stresshormonprofil (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin im 24h-Urin) → zeigt sympathische Aktivierung.
- Schilddrüsenparameter (TSH, fT3, fT4) → wichtig, da Cortisol und Schilddrüsenhormone sich gegenseitig beeinflussen.
Wirkung von Cortisol im Körper
Cortisol ist ein lebenswichtiges Hormon mit einer sehr breiten Wirkung im gesamten Organismus.
Es wird häufig als „Stresshormon“ bezeichnet, weil es in belastenden Situationen vermehrt ausgeschüttet wird, um den Körper schnell anpassen und reagieren zu lassen. Seine Wirkung geht aber weit über Stress hinaus.
Im Stoffwechsel sorgt Cortisol dafür, dass dem Körper ausreichend Energie zur Verfügung steht. Es steigert die Zuckerneubildung in der Leber (Gluconeogenese), hemmt die Wirkung von Insulin und fördert dadurch einen höheren Blutzuckerspiegel. Das ist in Stresssituationen sinnvoll, weil Gehirn und Muskeln dann mehr Energie erhalten. Wird Cortisol jedoch dauerhaft erhöht ausgeschüttet, kann dies zu:
- Gewichtszunahme, insbesondere im Bauchbereich,
- und zu Insulinresistenz führen.
- Auf das Immunsystem wirkt Cortisol dämpfend.
- Es unterdrückt Entzündungen und übermäßige Abwehrreaktionen. Deshalb wird es medizinisch oft als entzündungshemmendes oder immunsuppressives Medikament (z. B. Cortison) eingesetzt.
- Bei dauerhaft hohen Cortisolspiegeln kann das Immunsystem allerdings geschwächt werden, was Infektanfälligkeit oder verlangsamte Wundheilung begünstigt.
- Im Herz-Kreislauf-System unterstützt Cortisol die Blutdruckregulation.
- Es sorgt dafür, dass die Gefäße angemessen auf andere Hormone wie Adrenalin reagieren können.
- Bei zu hohen Cortisolwerten über längere Zeit kann es aber zu Bluthochdruck kommen.
- Im Gehirn steigert Cortisol die Wachheit, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. K
- urzfristig hilft es, klar zu denken und schnell zu reagieren.
- Wenn der Spiegel aber chronisch erhöht ist, kann das zu Nervosität, Reizbarkeit, Schlafstörungen oder depressiven Verstimmungen führen.
- In den Muskeln und Knochen wirkt Cortisol abbauend: Es fördert den Abbau von Muskelprotein, um daraus Zucker zu gewinnen, und hemmt die Knochenbildung.
- Deshalb kann langfristig ein zu hoher Cortisolspiegel Muskelabbau oder Osteoporose begünstigen.
Auch auf die Psyche hat Cortisol einen deutlichen Einfluss. - In akuten Stressphasen fördert es Motivation, Fokus und Leistungsfähigkeit.
- Bei langanhaltendem Stress und Erschöpfung kann die Cortisolproduktion jedoch absinken – dann fühlt man sich müde, antriebslos und emotional erschöpft.
Was bedeuten dauerhaft abweichende Cortisolwerte?
Cortisolwerte können je nach Lebenssituation, Stresslevel und Gesundheitszustand stark schwanken. Wichtig ist weniger ein einzelner Messwert, sondern das Muster über den Tag und über längere Zeit.
Wenn Cortisol dauerhaft zu hoch oder zu niedrig ist, kann das auf unterschiedliche Störungen der Stressregulation hinweisen.
Dauerhaft erhöhte Cortisolwerte deuten häufig auf eine anhaltende Aktivierung des Stresssystems hin. Das bedeutet, dass der Körper ständig „auf Alarm“ steht – auch wenn eigentlich keine akute Gefahr besteht. Ursachen können chronischer psychischer oder körperlicher Stress, Überarbeitung, Schlafmangel, emotionale Belastung oder Entzündungsprozesse im Körper sein. In solchen Fällen bleibt die HPA-Achse überaktiv, und Cortisol wird fortlaufend ausgeschüttet.
Langfristig kann dies zu Symptomen wie innerer Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, Gewichtszunahme (vor allem im Bauchbereich), erhöhtem Blutdruck, Reizbarkeit und einem geschwächten Immunsystem führen.
Auch depressive Verstimmungen oder ein sogenannter „Burnout-Zustand“ können mit chronisch erhöhtem Cortisolspiegel einhergehen. In seltenen Fällen kann ein krankhaft erhöhter Spiegel auch durch hormonelle Störungen entstehen, etwa beim Cushing-Syndrom (Überfunktion der Nebennierenrinde oder ACTH-produzierender Tumor).
Dauerhaft erniedrigte Cortisolwerte können dagegen auf eine Erschöpfung der Nebennieren oder eine Schwächung der Steuerung durch die Hypophyse hindeuten. Das tritt oft nach langen Stressphasen auf, wenn der Körper „ausgebrannt“ ist und die Cortisolproduktion nicht mehr richtig anpasst.
Menschen mit niedrigen Cortisolspiegeln fühlen sich häufig sehr müde, antriebslos und erschöpft. Sie leiden oft unter niedrigem Blutdruck, Schwindel, Konzentrationsproblemen und einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Stress. Auch Unterzuckerung, Muskelschwäche und depressive Verstimmungen können auftreten. Eine ausgeprägte Nebennierenunterfunktion nennt man Addison-Krankheit – diese ist jedoch selten und muss medizinisch behandelt werden.
Im Allgemeinen gilt: Ein ausgewogener Cortisolrhythmus – also hoch am Morgen, niedrig am Abend – ist entscheidend für Energie, Leistungsfähigkeit, guten Schlaf und seelische Stabilität. Abweichungen davon zeigen, dass das Stresssystem aus dem Gleichgewicht geraten ist. Je nach Richtung (zu hoch oder zu niedrig) kann dies Hinweise auf Überforderung oder Erschöpfung geben und sollte, besonders bei anhaltenden Symptomen, weiter ärztlich abgeklärt werden.